Ist Fingerknacken wirklich ungesund? Oft wird behauptet, das Knacken mit den Fingern sei ein Faktor, der zur Entstehung von Arthritis oder angeschwollenen Knöcheln beiträgt. Wir haben uns angeschaut, ob das stimmt – oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
Wilkommen bei „Everyday Science“! Hier versuchen wir Fragen aus dem Alltag so gut es geht zu beantworten – nach wissenschaftlichen Standards. Wir recherchieren stets nach bestem Wissen und Gewissen, können aber keine Garantie auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität geben.
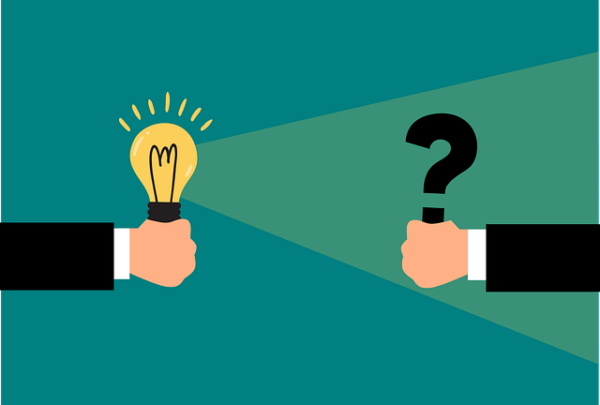
Falls du einen Fehler gefunden hast, oder einen Verbesserungsvorschlag hast zögere nicht und melde dich! Du hast einen Themenvorschlag, eine Frage? Auch dann melde dich gerne bei uns!
Zusammenfassung: Ist Fingerknacken wirklich ungesund?
Nein, wissenschaftliche Daten liefern keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Knacken mit den Fingern ungesund, oder schädlich für die Handfunktion ist, oder zu Arthritis führt.
Allerdings: Die Datenlage ist nicht ausreichend, und zum Teil widersprüchlich.
Ausführlichere Informationen findest du unten, unter „Datenlage„.
Einleitung
Häufig wird in Artikeln zum Thema Fingerknacken angegeben, es gäbe keine Studien zu dem Thema, was aber nicht stimmt. Allerdings sind es nicht viele Studien, außerdem sind einige bereits sehr alt, oder es handelt sich um Einzelfallstudien, die in Ihrer Aussagekraft offensichtlich begrenzt sind.
Was besonders auffällt: Oft liest man von einer „Studie“ aus dem Jahr 1998 in der der Autor einen Selbstversucht unternimmt. Er knackte mit einer Hand, und mit der Anderen nicht – über 50 Jahre. Am Ende sind beide Hände gesund, Gelenkprobleme, Funktionseinschränkungen oder motorische Probleme seien keine entstanden. Diese eher scherzhafte Anekdote stammt aus einem Leserbrief in der Fachzeitschrift „Arthritis & Rheumatism“ (1), und ist natürlich als Beleg nicht ausreichend. Diese „Evidenz“ wird oft als relevanter Befund präsentiert, wenn es um das Thema geht, zum Teil sogar von großen deutschen Krankenkassen, auf deren offiziellen Websites (3).
Direkt in der gleichen Ausgabe – als Antwort auf den eben beschriebenen Beitrag – meldet sich der Autor, der wohl ältesten Studie zu diesem Thema selbst zu Wort. Er verfasste seine Studie 1975 zusammen mit seinem damals 12-jährigen Sohn (1). Sie untersuchten 28 Senior:innen, die angaben, in Ihrem Leben viel oder wenig mit den Fingern geknackt zu haben. Auch hier wurde kein Zusammenhang zwischen Erkrankungen der Hand und Fingerknacken gefunden (2).
Datenlage:
Studie 1: Keine Arthritis, aber Funktionseinschränkungen
Eine Studie mit 300 Versuchspersonen (von denen 74 regelmäßig mit Ihren Fingern knackten; alle 45 Jahre oder älter) fand keinen Zusammenhang zwischen Fingerknacken und Arthritis in der Hand (4).
- Die 74 Fingerknacker:innen berichteten statistisch signifikant häufiger von Schwellungen der Hand, und zeigten eine geringere Griffstärke.
- Aber: Die Gruppen zeigen ebenfalls statistisch signifikante, aber kleine Unterschiede hinsichtlich verschiedener anderer Faktoren, die die Handfunktion beeinflussen können. Sie arbeiteten häufiger mit den Händen, tranken mehr Alkohol und rauchten häufiger.
- Das schränkt die Interpretierbarkeit des Ergebnisses sein, weil nicht gut unterschieden werden kann welche der Gruppenunterschiede welchen Effekt hat, oder ob sich diese gegenseitig bedingen (5).
Exkurs: Was bedeutet es, wenn sich zwei Gruppen „signifikant“ unterscheiden?
Eine signifikante Differenz ist ein Begriff aus der Statistik, der hier nur heruntergebrochen erklärt werden soll. Man spricht dann von einem signifikanten Unterschied, wenn dieser auf die tatsächliche Gruppeneinteilung (z.B. „Fingerknacken“ vs. „Kein Fingerknacken“) zurückgeht, und nicht auf andere Faktoren, wie z.B. den Zufall. Die Wahrscheinlichkeit dafür kann man berechnen. Liegt die Wahrscheinlichkeit über einem gewissen Wert, dem sog. Signifikanzniveau, spricht man von einem signifikanten Ergebnis. Das Signifikanzniveau wird üblicherweise auf 95% oder 99% festgelegt.
Sprich: Unterscheiden sich die Gruppen signifikant, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich an der Gruppenzuteilung (idF. anhand des Fingerknackens) liegt mindestens 95%, oder größer.
Studie 2: Kein Zusammenhang zwischen Fingerknacken und Arthritis
In dieser größer angelegten sog. Fall-Kontroll-Studie aus 2011 wurden 215 Versuchspersonen (50 bis 89 Jahre alt) untersucht. 135 Personen hatten Arthritis in einer Hand, die restlichen Personen nicht. Zwischen den beiden Gruppen unterschied sich die Häufigkeit des Fingerknacken nicht signifikant (6).
- Das deutete darauf hin, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Entwicklung einer Arthritis und Fingerknacken gibt.
Exkurs: Was sind Fall-Kontroll-Studien?
In Fall-Kontroll-Studien werden erkrankte Versuchspersonen mit gesunden Versuchspersonen (der sog. Kontrollgruppe) verglichen. Dann wird retrospektiv (d.h. „rückblickend“) nach einer Krankheitsursache gesucht, indem oft eine Reihe möglicher Risikofaktoren erfragt wird. Unterscheiden sich die beiden Gruppen hinsichtlich dieser Risikofaktoren, kann dies darauf hindeuten, dass sie einen Einfluss auf die Entwicklung der Erkrankung hatten.
Studie 3: Dicke des Mittelhandknorpels & Griffstärke
Die bisher vorgestellten Studien haben sich vor allem mit dem Risiko für die Entwicklung einer Arthritis beschäftigt, die folgende Studie beschäftigt sich dagegen mit der Griffstärke (vgl. Studie 1), und der Dicke des Mittelhandknorpels (7).
- Verglichen wurden 35 fingerknackende Personen mit 35 möglichst ähnlichen (hinsichtlich Alter, Geschlecht, usw.) Kontrollpersonen, die nicht mit den Fingern knackten. Eine wichtige Einschränkung: Die Versuchspersonen waren mit durchschnittlich 24 Jahren deutlich jünger als in den anderen hier dargestellten Studien.
- Die Dicke des Mittelhandknochen-Knorpels war bei Personen, die regelmäßig ihre Finger knacken signifikant größer als in der Kontrollgruppe. Eine Verdickung an Knorpeln und Gelenken gilt als ein frühes Symptom von Arthritis.
- Hinsichtlich der Griffstärke unterschieden sich die beiden Gruppen nicht.
Quellen
(1) Unger, D. L. (1998). Does knuckle cracking lead to arthritis of the fingers? Arthritis & Rheumatism, 41(5), 949–950. https://doi.org/10.1002/1529-0131(199805)41:5%3C949::AID-ART36%3E3.0.CO;2-3
(2) Swezey, R. L. & Swezey, S. E. (1975). The Consequences of Habitual Knuckle Cracking. Western Journal of Medicine, 122(5), 377–379. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1129752/pdf/westjmed00297-0049.pdf
(3) AOK – Die Gesundheitskasse (3. Februar 2022). Ist Knacken mit den Fingern ungesund? https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/muskel-skelett-system/ist-knacken-mit-den-fingern-ungesund/
(4) Castellanos, J. & Axelrod, D. (1990). Effect of habitual knuckle cracking on hand function. Annals of the rheumatic diseases, 49(5), 308–309. https://doi.org/10.1136/ard.49.5.308
(5) Simkin, P. A. (1990). Habitual knuckle cracking and hand function. Annals of the rheumatic diseases, 49(11), 957. https://doi.org/10.1136/ard.49.11.957-b
(6) Deweber, K., Olszewski, M. & Ortolano, R. (2011). Knuckle cracking and hand osteoarthritis. Journal of the American Board of Family Medicine : JABFM, 24(2), 169–174. https://doi.org/10.3122/jabfm.2011.02.100156
(7) Yildizgören, M. T., Ekiz, T., Nizamogullari, S., Turhanoglu, A. D., Guler, H., Ustun, N., Kara, M. & Özçakar, L. (2017). Effects of habitual knuckle cracking on metacarpal cartilage thickness and grip strength. Hand surgery & rehabilitation, 36(1), 41–43. https://doi.org/10.1016/j.hansur.2016.09.001
Mehr zum Nachlesen
(A) Powers, T., Kelsberg, G. & Safranek, S. (2016). Clinical Inquiry: Does knuckle popping lead to arthritis? The Journal of family practice, 65(10), 725–726.
(B) Rizvi, A., Loukas, M., Oskouian, R. J. & Tubbs, R. S. (2018). Let’s get a hand on this: Review of the clinical anatomy of „knuckle cracking“. Clinical anatomy (New York, N.Y.), 31(6), 942–945. https://doi.org/10.1002/ca.23243
(C) Watson, P., Hamilton, A. & Mollan, R. (1989). Habitual joint cracking and radiological damage. BMJ (Clinical research ed.), 299(6715), 1566. https://doi.org/10.1136/bmj.299.6715.1566